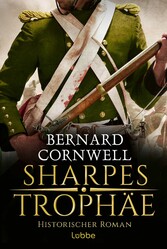Suchen und Finden
KAPITEL 1
Die Kanonen waren zu hören, lange bevor sie in Sicht kamen. Kinder klammerten sich an die Rockschöße ihrer Mütter und wunderten sich, was das für ein schreckliches Ding sei, das solche Geräusche hervorbrachte. Der Hufschlag der großen Pferde begleitete das Gerassel von Zugriemen und Ketten und das hohle Rumpeln der wirbelnden Räder. Das alles wurde übertönt von dem Krachen, mit dem Tonnen von Messing, Eisen und Holz über das geborstene Straßenpflaster der Stadt gezogen wurden. Und dann sah man sie: Kanonen, Lafetten, Pferde und Vorreiter, und die Kanoniere, deren Gesichter ähnlich abweisend wirkten wie die dicken, geschwärzten Fässer, die von den Kämpfen im Norden zeugten, wo die Artillerie ihre massiven Waffen durch angeschwollene Flüsse und über regendurchtränkte Hänge gezogen hatte, um Tod und Verderben über den Feind zu bringen. Nun würden sie es noch einmal versuchen. Mütter hielten ihre Kleinsten umschlungen, zeigten auf die Kanonen und prahlten damit, wie diese Briten Napoleon so weit bringen würden, sich zu wünschen, er wäre auf Korsika geblieben und hätte Schweine großgezogen, das Einzige, wozu er fähig sei.
Und erst die Kavallerie! Die portugiesischen Zivilisten applaudierten den vorbeitrottenden Reihen prächtiger Uniformen, den gebogenen, glänzenden Säbeln, die man aus der Scheide gezogen hatte, um sie in den Straßen von Abrantes zur Schau zu stellen. Da war der feine Staub, den die Hufe der Pferde aufwirbelten, ein geringer Preis, den es für den Anblick der herrlichen Regimenter zu zahlen galt, die nach Meinung der Stadtbevölkerung die Franzosen geradewegs über die Pyrenäen und zurück in die Gossen von Paris treiben würden.
Von Norden und Süden, von den Häfen an der Westküste her strömten die Soldaten zusammen und marschierten gen Osten auf der Straße, die der spanischen Grenze und dem Feind entgegenführte. Portugal würde befreit, Spaniens Stolz neu entfacht, Frankreich erniedrigt werden, und dann konnten diese britischen Soldaten in ihre eigenen Weinschenken zurückkehren und Abrantes und Lissabon, Coimbra und Oporto in Frieden zurücklassen.
Die Soldaten selbst waren weniger zuversichtlich. Sicher, sie hatten Soults Heer im Norden geschlagen, doch während sie in die eigenen, länger werdenden Schatten marschierten, fragten sie sich, was sie wohl hinter Castelo Branco erwartete, der nächsten und letzten Stadt vor der Grenze. Bald würden sie erneut den blauberockten Veteranen von Jena und Austerlitz gegenüberstehen, den Helden der Schlachtfelder Europas, den französischen Regimentern, die schon die besten Heere der Welt zerschlagen hatten.
Das Stadtvolk war beeindruckt, zumindest von der Kavallerie und Artillerie, doch für das erfahrene Auge waren die Truppen, die sich um Abrantes zusammenzogen, jämmerlich klein und die französischen Heere im Osten bedrohlich groß. Das britische Kontingent, das den Kindern von Abrantes so gewaltig vorkam, konnte den französischen Marschällen keine Angst einflößen.
Lieutenant Richard Sharpe, der in seinem Quartier am Stadtrand auf Befehle wartete, sah zu, wie die Kavallerie die Säbel wegsteckte, nachdem man die letzten Zuschauer hinter sich gelassen hatte, und wandte sich wieder der Aufgabe zu, den schmutzigen Verband von seinem Oberschenkel zu wickeln.
Als die letzten klebrigen Reste abgeschält waren, fielen einige Maden zu Boden, und Sergeant Harper ging in die Knie, um sie aufzuheben, ehe er die Wunde besah.
»Verheilt, Sir. Wunderschön.«
Sharpe knurrte. Die Säbelwunde hatte sich in neun Zoll verzogenen Narbengewebes verwandelt, das sich sauber und rosig von der dunkleren Haut abhob. Er riss die letzte fette Made ab und überreichte sie Harper zur sicheren Aufbewahrung.
»So, meine Schöne, wohlgenährt bist du.« Sergeant Harper verschloss die Büchse und blickte zu Sharpe auf. »Sie hatten Glück, Sir.«
Allerdings, dachte Sharpe. Der französische Husar hätte ihm beinahe den Garaus gemacht. Der kraftvoll von oben nach unten geführte Säbelhieb hatte sein Ziel fast schon erreicht, als Harpers Gewehrkugel den Franzosen aus dem Sattel hob, dessen Grimasse, eingerahmt von den unheimlichen Rattenschwänzen, plötzlich in Agonie erstarrte. Sharpe war verzweifelt ausgewichen, und der auf seine Kehle gerichtete Säbel hatte sich in seinen Oberschenkel gebohrt. Eine weitere Narbe zum Andenken an sechzehn in der britischen Armee verbrachte Jahre. Eine tiefe Wunde war das nicht gewesen, aber Sharpe hatte zu viele Männer an kleineren Schnittverletzungen sterben gesehen, mit Blutvergiftung und verfärbtem, stinkendem Fleisch. Die Ärzte hatten sich jeweils nicht anders zu helfen gewusst, als den Verletzten in einem der Leichenhäuser, die sie Hospitäler nannten, bis zu seinem Tode schwitzen und verkommen zu lassen. Ein paar Maden brachten mehr zuwege als jeder Feldarzt, indem sie das kranke Gewebe wegfraßen, sodass sich das gesunde Fleisch auf natürliche Weise wieder schließen konnte. Der Lieutenant stand auf und belastete prüfend das Bein. »Danke, Sergeant. So gut wie neu.«
»War mir ein Vergnügen, Sir.«
Sharpe streifte die Kavalleriemontur über, die er statt der vorgeschriebenen grünen Hosen der 95th Rifles trug. Er war stolz auf die grüne Uniform mit den schwarzen Lederflicken, die er im vergangenen Winter dem Leichnam eines Chasseurs aus Napoleons Leibregiment abgenommen hatte. Die Außenseite eines jeden Hosenbeins war mit mehr als zwanzig Silberknöpfen verziert gewesen, mit denen Sharpe in den Tavernen Essen und Trinken für seine Scharfschützen bezahlt hatte, die durch die galizischen Schneefelder nach Süden geflohen waren. Er hatte Glück gehabt, den Chasseur zu erwischen. Es gab in beiden Heeren nicht viele Männer, die so groß wie Sharpe waren, doch diese Montur passte wie angegossen, und die weichen, soliden schwarzen Lederstiefel des Franzosen hätten eigens für den englischen Lieutenant angefertigt sein können.
Patrick Harper hatte es da schwerer. Der Sergeant überragte Sharpe um volle vier Zoll, und der riesenhafte Ire wartete immer noch sehnsüchtig darauf, eine ordentliche Hose zu finden, einen Ersatz für seine ausgeblichenen, geflickten und zerlumpten Beinkleider, mit denen man kaum noch die Krähen von einem Rübenfeld verjagen konnte.
Die gesamte Kompanie sieht so aus, dachte Sharpe, ihre Uniformen sind fadenscheinig, ihre Stiefel werden praktisch nur noch von Fellstreifen zusammengehalten. Und solange ihr Heimatbataillon zu Hause in England weilte, würde Sharpes kleine Schar keinen Feldzeugmeister finden, der bereit war, seine Buchführung dadurch zu komplizieren, dass er ihnen neue Hosen oder Schuhe zuwies.
Sergeant Harper reichte dem Lieutenant seine Uniformjacke. »Möchten Sie ein ungarisches Bad, Sir?«
Sharpe schüttelte den Kopf. »Es geht schon.« In der Jacke hausten zwar einige Läuse, aber noch nicht genug, als dass es gerechtfertigt gewesen wäre, die Uniform dem Rauch eines Grasfeuers auszusetzen, sodass sie für die nächsten Tage wie ein Kohlenbrenner gestunken hätte. Die Jacke war so abgetragen wie alle anderen auch in dieser Kompanie, aber nichts, nicht einmal der bestgekleidete Leichnam Portugals oder Spaniens, hätte Sharpe dazu bringen können, sie wegzuwerfen. Sie war grün wie die dunkelgrüne Jacke der 95th Rifles, und sie war das Kennzeichen eines Eliteregiments.
Die britische Infanterie trug Rot, aber die Besten in der britischen Infanterie trugen Grün, und selbst nach drei Jahren bei den 95th Rifles hatte Sharpe noch Freude an der Auszeichnung, welche die grüne Uniform bedeutete. Sonst besaß er nichts, nur seine Uniform und das, was er auf dem Rücken mit sich tragen konnte. Richard Sharpe kannte keine andere Heimat als das Regiment, keine Familie außer seiner Kompanie und keinen Besitz bis auf das, was in seinen Tornister und seine Taschen passte. Er kannte keine andere Art zu leben, und er erwartete, so zu sterben.
Um die Taille band er sich die rote Offiziersschärpe und darüber den schwarzen Lederriemen mit der silbernen, schlangenförmigen Gürtelschnalle. Nach einem Jahr auf der Iberischen Halbinsel deuteten nur noch die Schärpe und sein schwerer Degen auf seinen Offiziersrang hin, und selbst seine Waffe entsprach, genau wie die Montur, nicht den Vorschriften. Offiziere der Rifles hatten wie alle Offiziere der Leichten Infanterie einen gebogenen Säbel mitzuführen, aber Sharpe missfiel diese Waffe. Stattdessen trug er den langen geraden Degen der Schweren Kavallerie, ein Ungetüm von einer Waffe, schlecht ausbalanciert und grob, doch Sharpe behagte das Gefühl, eine primitive Waffe zu halten, mit der er die schlanken Klingen französischer Offiziere niederschlagen und Muskete und Bajonett beiseitehauen konnte.
Der Degen war nicht seine einzige Waffe. Zehn Jahre lang war Richard Sharpe in den Reihen der Rotröcke marschiert, zunächst als einfacher Soldat, dann als Sergeant, und hatte eine Muskete mit glattem Lauf über die Tiefebenen Indiens getragen. Er hatte mit der schweren Steinschlossflinte in der Formation gestanden, war von Entsetzen erfüllt mit einem Bajonett in die Bresche gesprungen, und auch jetzt noch führte er in jeder Schlacht eine Langwaffe mit sich. Das Baker-Gewehr zeichnete ihn aus, hob ihn von den anderen Offizieren ab, und die sechzehnjährigen Ensigns, die man frisch in ihre nagelneuen Uniformen gesteckt hatte, waren auf der Hut vor dem hoch gewachsenen schwarzhaarigen Lieutenant mit dem umgehängten Gewehr und der Narbe, die seinem Gesicht, außer beim Lächeln, den Ausdruck grimmiger Belustigung verlieh. Manch einer fragte sich, ob die Geschichten stimmten, Geschichten vom indischen Kontinent aus Seringapatam und Assaye, doch ein Blick aus den scheinbar spöttischen Augen oder der Anblick der abgenutzten Griffe seiner Waffen...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.