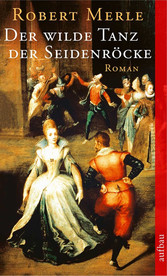Suchen und Finden
ERSTES KAPITEL
Wenn man von der Taufe eines Menschen auf seinen späteren Werdegang schließen könnte, hätte ich mir, da die meine geradezu glorreich war, ohne weiteres erhoffen dürfen, eines Tages die höchsten Staatsämter zu bekleiden. Ob ich mir darauf aber soviel hätte einbilden sollen, weiß ich nicht. Bestimmt hatte ja die Ehre, daß Heinrich IV. bei mir Pate stand, nichts mit den Verdiensten eines quärrenden Knäbleins zu tun, sondern mit der Gunst, die mein Vater genoß, der erste Marquis de Siorac, sowie mit den inständigen Bitten meiner lieben Patin, der Herzogin von Guise, die mir – sogar schon vor meiner Geburt – so zärtlich zugetan war, daß es ihren ältesten Sohn erzürnte. Allerdings war, wie Richelieu es einmal so grausam formulierte, des jungen Herzogs »Verstand nicht größer als seine Nase«; der Hof nämlich fand diesen Fortsatz an ihm lächerlich klein.
Und jetzt, da ich es als reifer Mann bedenke, kann der Prunk meiner Taufe mich erst recht nicht blenden. Von den drei Patenkindern Heinrichs IV. war ich das einzige, dem das Glück hold war, mehr allerdings auf Grund meiner treuen Dienste als eingedenk jenes glänzenden Anfangs. Das berühmteste königliche Patenkind, Heinrich II. von Montmorency, wurde unter Ludwig XIII. wegen Hochverrats enthauptet. Das ruhmloseste, zumindest von der Geburt her, Marie Concini, eine Tochter des Concino Concini und der Leonora Galigai, starb mit acht Jahren.
Ich war schon ein Jahr1, als ich getauft wurde – späte Taufen waren damals Mode –, und es mag dem Leser einleuchten, daß ich die Ehre, den König zum Paten zu haben, in dem Alter nicht besonders empfand. Ganz im Gegenteil. Denn als ich, wie es mir mehr als hundertmal erzählt worden ist, aus dem molligen Schoß Gretas, meiner elsässischen Amme, gehoben und den königlichen Händen überantwortet wurde, ergriffen mich diese so ungeschickt, daß ich fast zu Boden gestürzt wäre und nur im letzten Augenblick, noch dazu mit einer Härte gepackt wurde, daß ich, hocherregt ob der gewaltsamen Erschütterung, aus vollem Hals losbrüllte.
»Ist das ein Schreihals!« sagte der König. »Aus dem machen wir einen großen Prediger, wie unser Freund Du Perron ...«
Woraufhin alle Umstehenden lachten, auch der Kardinal Du Perron selbst, der mir unter Beihilfe des Abbé Courtil, Pfarrer von Saint-Germain-l’Auxerrois, und seiner geistlichen Diener, die Ölung gab.
»Oh, Sire!« sagte die Herzogin von Guise, »hütet Euch, meinen Sohn fallen zu lassen.«
»Euren Sohn, liebe Cousine?« fragte der König. »Ihr wolltet natürlich Patensohn sagen.«
Und obwohl Heinrich – unser großer König Henri Quatre – sie damit foppen wollte, rang sich Monseigneur Du Perron, wie Greta mir erzählte, diesmal nur ein dünnes Lächeln ab.
»In Fahrheit«, fuhr Greta fort, die das »w« wie »f«, das »d« wie »t« und überhaupt weiche Laute hart aussprach, weil sie Elsässerin war, »in Fahrheit hatte der König, während der Kartinal seines Amtes faltete, nämlich nur Augen für die Frau Marquise de Verneuil, die ja schön war wie die Liepe selbst und prächtig ganz in Krün gekleidet und mit zwölf Tiamanten im schwarzen Haar.«
»Hast du sie gezählt, Greta?« fragte ich, als ich schon größer war.
»Tas nicht, aber als wir von Saint-Germain-l’Auxerrois zum Loufre zurückkehrten, wo uns ein schönes Mahl erfartete, sagte der König zur Marquise: ›Liebste, Ihr habt ja nur zwölf Diamanten im Haar. Nach der neuesten Mode müßtet Ihr fünfzehn tragen.‹ – ›Woraus ich schließe, Sire‹, gab die Marquise zurück, ›daß Ihr mir die drei fehlenden schenken wollt.‹ Eine Keriebene war tas! Und was für schöne Forte sie machen konnte, um ihren Liephaper zu kirren.«
»Und wie schön war die Marquise?« fragte ich.
»Nun sehe sich tas einer an!« sagte Greta. »Kaum aus dem Ei geschlüpft, noch naß hinter den Ohren, und schon interessiert sich das Hähnchen für die Hennen! Na ja«, fuhr sie fort und vergaß, daß sie Madame de Verneuil eben noch »schön wie die Liepe selbst« genannt hatte, »kenau genommen war sie so eine Lange, Dunkelhaarige, hatte so kelbliche Haut und einen kroßen Mund.«
Hiermit ging Greta wie üblich und holte meine Taufurkunde aus einer Kassette, die auf Anordnung meines Vaters im Geheimfach eines kleinen Ebenholzschrankes aufbewahrt wurde. Sie hielt sie mir hin und forderte, ich solle den Text laut vorlesen, weil sie des Lesens unkundig war.
Da stand denn auf schönem Pergament geschrieben, daß in der Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois durch Monseigneur Du Perron die Taufe des Pierre-Emmanuel de Siorac, Sohn des Marquis de Siorac und seiner Gemahlin Angelina geborene de Montcalm, vollzogen wurde und daß Seine Majestät der König und Ihre Hoheit, die Herzogin von Guise, die Paten waren. Die Ölung wurde dem Kinde erteilt in Anwesenheit Seiner Majestät, Ihrer Hoheit, seines Vaters, des Herrn Marquis de Siorac, der Frau Marquise de Verneuil, des Herrn Duc de Sully, des Herrn de Villeroi und des Herrn de Sillery.
Eines Tages betrachtete ich mir die Unterschriften der Beteiligten genauer, als ich es bis dahin getan hatte, weil ich mich zu der Zeit gerade an meinem eigenen Namenszug versuchte: ein Unterfangen, auf das ich seit jüngstem eine heiße Mühe verwandte, als hingen mein Charakter, mein Schicksal, mein Fortkommen im Staate, meine dereinstigen Liebschaften, ja mein ganzes Leben von einem hübsch geschwungenen Schnörkel ab.
»Aber Greta«, sagte ich, »wieso hat meine Mutter nicht unterschrieben?«
»Feil sie nicht dapei war«, sagte Greta.
»Wie? Nicht bei der Taufe ihres Sohnes? War sie leidend?«
»Ich weiß nicht, Liepling«, sagte Greta, »tas mußt du den Herrn Marquis fragen.«
»Und weshalb habe ich denselben Vornamen wie mein Bruder Pierre, der schon fünfzehn Jahre älter ist als ich?«
»Weil es die Herzogin so gefollt hat.«
»Und warum hat das nicht meine Mutter bestimmt?«
»Ich weiß nicht.«
»Und wieso bin ich hier aufgewachsen und nicht bei ihr in Montfort-l’Amaury?«
»Mein Liepling«, sagte Greta ganz bestürzt, »liebt Ihr nicht Euren Vater, und bin ich denn kar nichts für Euch, ebenso wie Mariette und wir alle hier, die wir doch kanz vernarrt in Euch sind?«
Und wie sie dies sagte, rollten Tränen aus ihren blauen Augen auf ihre schönen rosigen Wangen.
»Ach, Greta«, rief ich und warf mich an ihren Hals, »das weißt du doch! Ich habe meinen Vater sehr lieb, und dich auch, und alle hier im Haus.«
Greta war das Liebchen1 von unserem riesigen Lakaien Franz, der bei der Duchesse de Montpensier in Diensten stand, als mein Vater ihn kennenlernte. Während der Belagerung von Paris wäre er verhungert, hätte mein Vater ihm nicht mit ein bißchen Fleisch geholfen, denn der Arme hatte nichts, ebenso wie sein Liebchen; er aß heimlich die Wachslichte seiner Herrin – welche sie ihm, nachdem die Belagerung aufgehoben war, vom Lohn abzog und ihn entließ. So nahm ihn denn mein Vater in Dienst, machte ihn zu seinem maggiordomo und war es hoch zufrieden, denn Franz regierte unangefochten über unsere Kammerfrauen, weil seine treue Liebe zu Greta ihn gegen alles Schmeicheln und Maunzen unserer Kätzchen wappnete.
In meinen Windel- und Kinderjahren war ich Greta so nahe, trank mich an ihren Brüsten voll Leben, ihre Tochter Friederike an der einen Seite, ich an der anderen, daß ich nicht hätte sagen können, ob Greta groß oder klein, blond oder braun war. Man wird einwenden, daß ich ja wohl zu jung war, um mich jener Zeit zu erinnern. Oh, doch! Denn Greta säugte mich, bis ich vier war. Und wie gut entsinne ich mich des festen, süßen und wohlriechenden Fleisches, in das ich meine Patschen grub, jene runden Wonnekugeln, daran mein beseligtes Auge hing, und sogar, wie köstlich das Saugen selbst war, durch das ich mir die gute Milch in den Mund holte. Bewußt wurde ich mir dieser Herrlichkeiten erst, als ich sie entbehren mußte, aber nun, aus dem erzwungenen Abstand, konnte ich meine Amme endlich im ganzen erkennen.
Was war sie groß und üppig! Blonde Haare, blaue Augen, die Haut rosig, die Schultern breit, der Busen mächtig, die Zitzen groß, runde Hüften, kräftige Beine und eine Taille, ein Gewicht, ein Umfang, der Gefährtin eines Riesen würdig! Ganz zu schweigen von diesem Herzen, das großmütig unter ihren Rippen pochte, und dem immer ausgeglichenen Wesen bei aller Tagesmühe, einem Blick, so liebreich, und einer so warmen Stimme, daß man kaum glauben mochte, sie sei diesem elsässischen Monument entstiegen.
Da ich das »gr« ihres Namens wohl schwer aussprechen konnte, nannte ich sie »Ta«, und weil ich diese Vereinfachung auf alle anderen übertrug, nannte ich meinen Vater »Pa«, die Mariette von unserem Koch Caboche »Jette« und die Herzogin von Guise nicht eben respektvoll »Ise«.
Mariette kam in meiner Liebe zu unseren Bediensteten gleich nach Greta. Wie ihr Mann Caboche und dessen Cousin Lachaise, unser bärenstarker Kutscher, stammte auch sie aus der Auvergne. Brünett an Haut und Haar, klein, dick, rund, aber mit strammen Muskeln unterm Fleisch, war sie hart und schwarz wie Basalt von Saint-Flour und führte ein Mundwerk, daß kein Pariser Großmaul ihr überkam. Aus dem Grund hatte mein Vater sie ausersehen, den Senf einzukaufen, wie man bei uns für den ganzen Einkauf sagte, der ihr aber, der Senf, meine ich, rasch in die Nase steigen konnte, wenn der Schlächter, der Gemüsehändler oder das Fischweib sie übers Ohr hauen wollten.
Damals war es bei den Pariser Adelsfamilien üblich, sich von einem Lieferanten mit allem versorgen zu lassen, was die Küche täglich...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.