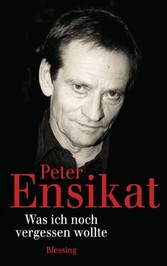Suchen und Finden
SPURENSUCHE
Ich wohne fast noch im Grünen. Da aber immer mehr Leute im Grünen leben wollen, werden hier immer mehr Häuser hingestellt mit der Folge, dass das Grüne langsam hinter den bunten Häusern verschwindet. Mein Haus, es stammt aus der Kaiserzeit, ist noch von jenem Grau, das einst das Bild der DDR geprägt hatte. Trotzdem finde ich mein Haus viel schöner als die meisten neuen bunten Fertighäuser ringsherum. Da die Leute, die das Haus vor mir besaßen, zu DDR-Zeiten nicht genug Geld hatten, um es zu modernisieren, sieht man ihm nicht nur sein schönes Alter, sondern auch seine alte Schönheit noch an. Verfall muss nicht immer so endgültig sein wie Sanierung. Der westliche Reichtum, scheint mir, hat im westlichen Nachkriegsdeutschland kaum weniger zerstört, als die östliche Armut hier hat verfallen lassen.
Für die Häuser jedenfalls kamen die neuen Besitzverhältnisse, so weit sie denn geklärt sind, gerade noch zurecht. Für die Menschen war es ein bisschen schnell. Ich hatte Glück: An meinem Haus gibt es keine ungeklärten Besitzverhältnisse. Ich hatte es, wenn auch zu DDR-Zeiten, so doch auch nach heutigem Rechtsverständnis ganz legal gekauft. So gut geht es nicht jedem.
Wenn ich aus meinem alten Dorf auf neuen Straßenbahnund S-Bahn-Gleisen ins Zentrum fahre – in die Stadt, sagen wir hier -, fahre ich an vielen dieser Plattenbauten vorbei, denen man mit neuer Farbe ein wenig von ihrer alten Hässlichkeit zu nehmen versucht hat. Die große Straße, die in die Stadt führt, hieß einmal Leninallee. Jetzt heißt sie wieder Landsberger Allee, und der Leninplatz, an dem einst das riesige Lenindenkmal stand, heißt jetzt Platz der Vereinten Nationen. Da, wo einst das Denkmal stand, liegen – irgendwie verloren – ein paar große Feld- oder Granitsteine. Der erbitterte Streit um den Abriss des gewaltigen Lenin ist längst vergessen. Aber auch wer den Platz nie mit dem Denkmal gesehen hat, dürfte merken, dass hier ein Loch ist in der Plattenbaulandschaft. Ein wesentlich hässlicheres Denkmal von Ernst Thälmann, nur ein paar hundert Meter entfernt, steht noch. Offizielle Begründung: Thälmann war zwar auch Kommunist, aber doch wenigstens ein Deutscher. Nein, wir kriegen die Vergangenheit nicht aus den Köpfen, auch die nicht, die viel weiter zurückliegt als die DDR. Der Russe gehört nicht in unser Straßenbild, auch wenn er – oder gerade weil er – dieses Bild hier so lange geprägt hat.
Wenn ich dann am Bahnhof Friedrichstraße aussteige, bin ich endlich da angekommen, wo es aussieht, als wäre hier schon immer Bundesrepublik gewesen. Dabei fällt mir gerade hier immer wieder ein, wie es zu Mauerzeiten ausgesehen hat. Letzte Spur – die hässliche Abfertigungshalle an der Grenze steht noch. Da, wo man sich von seinem Westbesuch trennen musste, und wo ich nicht nur fremde Tränen sah, gibt es heute unterhaltsame, manchmal auch kabarettistische Veranstaltungen. Was damals der Volksmund »Tränenpalast« nannte, heißt jetzt offiziell so. Ich habe inzwischen mehrmals da gesessen, wo einst die »Grenzkontrollorgane der DDR« die Reisenden das Fürchten lehrten. Wenn hier noch Tränen fließen, dann sind das höchstens Lachtränen.
Von den »DDR-Grenzsicherungsanlagen« ist auf dem Bahnhof nichts mehr zu spüren. Die verschiedenen Ein- und Ausgänge für »Bürger der BRD, Bürger aus Westberlin und anderen Staaten« sind nicht mehr zu erkennen. Die verschlossenen Türen sind verschwunden. Man kann allenfalls vermuten, wo man einmal gewartet hat auf die Ost-Oma, den West-Freund, auf Freunde und Kollegen aus Frankreich, Belgien, Schweden, den Westbesuch eben … Die kurze Begrüßung – meist etwas verlegen unter den Augen der anderen Wartenden und der uniformierten Grenzer – und das schnelle Nur-weg-hier, schließlich die stereotype Frage: Wie war’s denn diesmal? Damit war natürlich die allzeit willkürliche Grenz- beziehungsweise Zollkontrolle gemeint. Irgendwie fühlte sich unsereins mitverantwortlich für die Schikanen und alle an der Grenze versammelten Unfreundlichkeiten, mit denen der Staat DDR seine Gäste willkommen zu heißen pflegte.
Jetzt kann man da, wo achtundzwanzig Jahre lang alles verschlossen und vernagelt war, einfach durchgehen, durchsehen. Man kann sogar Kaffee trinken gehen in einem der jetzt zahlreichen Cafés. Wie früher, bevor die Grenze zu jenem »antifaschistischen Schutzwall« wurde, auch Mauer genannt. Und trotzdem ist hier nichts mehr so, wie ich es als Kind noch gekannt hatte, als ich mit meinem Onkel Erich über die »offene Grenze« schleppte, was uns den Westen so wertvoll machte – abgelegte Kleidung, Schokolade und allerlei Haushaltsgeräte von der Neuköllner Verwandtschaft. Dass wir den riesigen Umweg über die Friedrichstraße machten, um von Neukölln zurück nach Schöneweide zu kommen, das hatte sich mein im offenen Grenzübergang erfahrener Onkel Erich ausgedacht. Am Bahnhof Friedrichstraße hatte man – zumindest im Berufsverkehr – den DDR-Zoll nicht zu fürchten. Hier war einfach zu viel Betrieb, um uns auf die Schmugglerspuren zu kommen.
Dann kam die Mauer. Aus dem ehemaligen »Westbahnsteig« wurde Endstation für alle S-Bahnen, die aus Königswusterhausen, Schönefeld oder Bernau kamen. Eine schmutzige, undurchsichtige Glaswand trennte diesen Bahnsteig jetzt von den beiden anderen, die nur noch Ostrentner oder Westgäste betreten durften. Der ganze Bahnhof war eine einzige Grenzanlage mit Spürhunden und den allgegenwärtigen uniformierten und zivilen Grenzschützern. Das ist Gott sei Dank vorbei. Statt der Grenzanlagen ist jetzt hier so was wie eine Ladenstraße mit Gleisanschluss entstanden. Täuscht mich mein Eindruck, dass heutzutage aus allem, was unsere Architekten um- oder neubauen, zum Schluss immer Ladenstraßen werden? Und alles sieht aus wie Legoland – bunt, glatt, spurlos. Wer nicht weiß, dass der Bahnhof Friedrichstraße mal Grenzbahnhof war, eines der bestbewachten Löcher im Eisernen Vorhang, der wird es auch nirgendwo erkennen. Wenn ich nicht wüsste, dass sich hier einmal sehr traurige Menschengeschichten abgespielt haben, weil sich anonyme Weltpolitik zwischen ganz und gar nicht anonyme Menschen gedrängt hatte, ich würde nichts davon ahnen.
Der Ostberliner Schriftsteller Heinz Knobloch hat, als er nach Spuren jüdischen Lebens in Berlin und nach den Spuren von der Vernichtung dieses Lebens suchte, den Satz geprägt: »Misstraut den Grünanlagen!« Deutscher Umgang mit der Vergangenheit scheint seit jeher in der Beseitigung ihrer Spuren zu bestehen. In der DDR ließ man – in des Wortes doppelter Bedeutung – Gras drüber wachsen. Jetzt wird Beton drauf gegossen. Und wenn die Spuren dann alle beseitigt sind, merkt man manchmal, dass etwas fehlt. Und dann baut man sich ein Mahnmal gegen das schlechte Gewissen. Da können aus gegebenem Anlass Blumen und Kränze niedergelegt, Reden gegen das Vergessen gehalten und im Übrigen einfach dran vorbeigegangen werden.
Nachdem man in Berlin die Mauer abgerissen, in ihre Einzelteile zerlegt und diese in alle Welt verkauft hatte, wollten die Leute – darunter viele Touristen aus aller Welt – plötzlich wieder wissen, wo diese Mauer überhaupt gestanden hatte. Da Berlin die Touristen als »Wirtschaftsfaktor« braucht, machten sich ein paar höher beamtete Spaßmacher der Stadt daran, den Verlauf dieser Mauer auf Flächen, die noch nicht zugebaut waren, mit einem roten Strich zu markieren. Nun kann man also mit seinen Berlin-Besuchern auf diesem roten Strich entlanggehen, sofern auf dem verschwundenen Todesstreifen nicht gerade Autos parken. Aber damit nicht genug der Mahnung! In der Bernauer Straße hat man einen bescheidenen Mauerrest mit einem riesigen Mahnmal zugebaut. Durch kleine Löcher kann man dort das rührend kleine Stückchen Mauer mit dazugehörigem Todesstreifen besichtigen. Das wirkt so harmlos, wie das Mahnmal selbst in seiner hässlichen Belanglosigkeit erschüttert.
Wir Deutschen haben es in unserer Geschichte nicht nur zu den größten Verbrechen gebracht, wir errichten, nachdem alles vorbei ist und wir die Spuren verwischt haben, auch die größten Mahn- und Gedenkstätten. Diese wiederum dienen sowohl der repräsentativen Mahnung als auch der volkstümlich gebliebenen Schändung. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann brauchen wir bald denselben effektiven Wachschutz für unsere Mahnmale wie für unsere Asylbewerberheime.
In Brandenburg vergeht inzwischen kaum ein Tag, an dem nicht ein Denkmal oder so ein Heim beschmiert oder angezündet wird. Das hat sowohl mit deutscher Vergangenheit als auch mit unserer Gegenwart zu tun. Dass solcher Vandalismus im Osten noch häufiger ist als im Westen unseres toleranten Vaterlandes, gibt dem aufgeklärten Westdeutschen die schöne Gewissheit, der ganze Rechtsradikalismus sei ein Resultat des im Osten einst verordneten Antifaschismus und dieser ganzen vorzivilisatorischen Sozialisierung der Ostmenschen. Dass diese Jugendlichen inzwischen schon mehr als die Hälfte ihres bewussten Lebens in der Bundesrepublik verbracht haben und dass ihre schwarz-braunen Weisheiten zum großen Teil aus München oder Düsseldorf stammen, hindert nicht, die Schuld da zu suchen, wo man selbst ganz und gar unschuldig war – in jenen vierzig DDR-Jahren. Und das kommt einem, der diese vierzig Jahre DDR miterlebt hat, zumindest bekannt vor.
In der DDR erklärte man kurzerhand jede Art von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus, eigentlich die Kriminalität überhaupt, am liebsten mit den bösen Einflüssen, die da aus dem Westen bei uns eindrangen. In der Bundesrepublik hatte man schließlich nicht so schöne Lehren aus der Vergangenheit gezogen wie im konsequent antifaschistischen Osten. Heute führt dieselbe Spur zurück in die böse DDR-Kinderkrippe,...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.